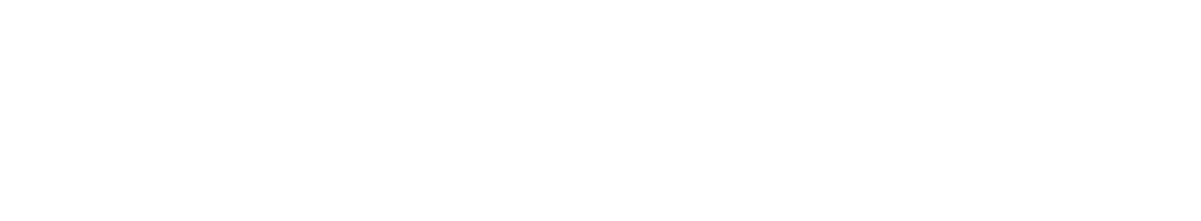„Eine Dauer von einer Stunde wäre zu harmlos“
Fünf Stunden lang müssen drei Künstler*innen bei FERNSTE GELIEBTE auf höchstem Niveau musizieren und improvisieren – ohne sich sehen zu können. Eine emotionale und körperliche Qual, die entscheidend ist, wie Dramaturg JULIAN KÄMPER von trugschluss erklärt
Text: Philipp Nowotny – Foto: Max Ott
HIDALGO: Julian, kurz und knapp: Was ist FERNSTE GELIEBTE?
Julian Kämper: Eine begehbare Konzertinstallation, die auf dem berühmten Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ von Ludwig van Beethoven beruht. Der Zyklus handelt zentral von unüberwindbarer Distanz. Diese machen wir sowohl für die Performenden als auch für das Publikum real erfahrbar.
Wer ist in welcher Rolle beteiligt?
Im Zentrum stehen die Mezzosopranistin Hagar Sharvit und der Pianist und Lyriker Daniel Gerzenberg. Diese für die Gattung Lied so typische Zweisamkeit aus Gesang und Liedbegleitung wird radikal aufgebrochen: Mit der Klangkünstlerin Martine-Nicole Rojina bildet sich ein Dreiergespann, das musikalisch mit- oder auch gegeneinander agiert. Idee, Inszenierung, Szenografie und künstlerische Realisierung stammen vom trugschluss-Kollektiv. Der HIDALGO hat als Koproduktionspartner mit uns den künstlerischen Rahmen entwickelt und die Realisierung ermöglicht.
Welche Kunstformen greifen hier ineinander?
Die Bezeichnung „begehbare Konzertinstallation“ besagt ja schon: Es ist zunächst mal ein Konzert, weil da drei Musiker*innen Musik machen. Wichtig und besonders ist der Aspekt des Installativen, dass die Besucher*innen sich also individuell durch das Geschehen bewegen können, selber ent-scheiden, was und wann sie etwas fokussieren, und damit ihre eigene Lesart entwickeln. Durch die szenografische Gestaltung kommt etwas Theatrales hinzu. Schlussendlich ist es ein Hybrid, der keine klaren Grenzen kennt – aber das ist ja auch das Interessante.

Du sagtest zu Beginn, FERNSTE GELIEBTE mache unüberwindbare Distanz erfahr-bar. Was hat Beethoven zum Beispiel mit modernen Fernbeziehungen zu tun?
In Beethovens Zyklus wird ja ein ganz konkretes Bild gezeichnet: Da sitzt jemand auf einem Hügel, blickt ins Tal und sieht oder halluziniert seine ehemals Geliebte. Dieses Bild kann man sicher nicht eins zu eins in unsere Gegenwart übersetzen, aber es gibt zahlreiche Verbindungen. Früher war es nicht möglich, große räumliche Distanzen mal eben zu überwinden. Heute sind wir so mobil, dass wir problemlos durch die Welt reisen – genau deshalb gehen wir aber auch Beziehungen, Freundschaften oder sonstige Verhältnisse mit Menschen an anderen Orten ein. Das heißt, dass man nicht mehr nur über physische Nähe und körperliche Berührung miteinander verbunden ist, sondern auf moderne Kommunikationsmedien zurück-greift – durch Corona kennen wir das alle. Im Beethoven-Zyklus wird offengehalten, ob die Geliebte verstorben ist oder aus räumlichen oder gesellschaftlichen Zwängen abwesend ist. Das ist auch heute noch relevant: Zusammensein wollen, aber nicht Zusammensein können aufgrund innerer oder äußerer Umstände. Ich denke, jeder von uns kennt das.
FERNSTE GELIEBTE zeigt über fünf Stunden, wie Beethoven immer einsamer wird, richtig?
Ja, Biografisches von Beethoven fließt hier ein. Zentral ist für uns der Prozess, dass er allmählich isoliert und taub wurde – durch sein (a)soziales Verhalten und die Erkrankung. Eines von vielen Mitteln, das die Klangkünstlerin verwendet, ist ein tinitusartiges Grundrauschen, das alle anderen Geräusche der Umgebung fast bedrohlich übertönt. Das vermischt sich mit dem Hauptstrang von FERNSTE GELIEBTE: Da sind zwei, die eigentlich zueinander gehören, in unserem Fall Sängerin und Pianist – die aber zu Beginn voneinander getrennt werden. Über mehrere Stunden beobachten wir, was diese Isolierung und Distanzierung emotional mit ihnen macht. Am Ende gehen die Boxen auf, Sängerin und Pianist können sich sehen, sie können sich aber nicht hören, weil sie Lärmschutzkopfhörer tragen – ob das ein gelungenes oder missglücktes Zusammenfinden ist, kann jeder selbst bewerten.
Der Liedzyklus „An die ferne Geliebte“ dauert eigentlich nur rund 15 Minuten. Wie verwandelt man ihn in eine fünfstündige Performance?
Zunächst mal, indem man Musik und Texte des Beethoven-Zyklus gründlich analysiert und in der Gruppe diskutiert. In kleinsten musikalischen Motiven, in einem Akkordwechsel oder in einem einzelnen Vers können ganze Gedankenwelten, Interpretationsansätze und Erzählungen stecken. Solche Schlüsselmomente haben wir fast wie Super-Slow-Motion gestreckt, um sie aus-kosten, genießen und intensivieren zu können. Ein einzelner Akkord kann also mal minutenlang im Raum stehen und wabern, sodass die Besucher*innen sich wirklich durch die Musik hindurchbewegen können, einen Klang aus unterschiedlichen Positionen hören können. Wir strecken aber nicht nur das Beethoven’sche Originalmaterial, denn die Aufführung ist voll von freien Assoziationen, Improvisationen, spontanen Interaktionen und Material aus Hoch- und Popkultur. Das alles ist aus unserer Auseinandersetzung mit dem Original-Zyklus heraus motiviert, kann sich aber auch extrem davon entfernen.

Muss ich ein Beethoven-Freak sein, der alle Werke von ihm kennt und alle Bücher über ihn gelesen hat, um die Performance zu verstehen?
Nein. Ganz einfach, weil die Grundsituation, dass da Menschen, die eigentlich gemeinsam agieren, räumlich voneinander getrennt sind, eine reale Situation ist, die alle Besucher*innen – egal mit welchem Vorwissen – unmittelbar erleben und nachvollziehen können.
Eine Gefahr ist, dass solche Inszenierungen zu verkopft wirken – war das den Beteiligten bewusst?
Klar. Wir Macher*innen befassen uns lange und intensiv mit dem Material, lesen, analysieren, diskutieren bis in kleinste Details. So eignet man sich ein spezifisches Fachwissen an, das man vom Publikum gar nicht erwarten kann. Dieses Wissen wollen wir über eine direkte, reale Erfahrung vermitteln. Deshalb „übersetzen“ wir unsere Themen und Fragestellungen in räumliche, körperliche und zeitliche Dimensionen, erzählen sie also sinnlich. Der „informierte Besucher“ mit Vorwissen wird immer wieder Referenzen, Zitate und Reminiszenzen erkennen und „Aha“-Erlebnisse haben. Das ist gut, aber kein Muss – man darf über bestimmte Situationen auch einfach schmunzeln, sie absurd, bescheuert oder irritierend finden, ohne sie verstehen zu müssen.
Eine andere Gefahr ist, dass die Qualität der Musik leidet, oder?
Einerseits ja, weil das Konzept erfordert, die Musiker*innen voneinander zu trennen und damit auch das musikalische Zusammenspiel bewusst zu stören oder zumindest zu erschweren. Die Distanz ist auch hier eine reale Hürde. Andererseits haben wir hier Musiker*innen, die trotz dieser Hindernisse die musikalische Qualität wahren, weil sie den Zyklus perfekt beherrschen, weil sie sensibel und aufmerksam auf die Situation reagieren und weil sie in der Lage sind, vermeintliche Störfaktoren für das künstlerische Resultat fruchtbar zu machen. Mit den elektronischen Soundwelten und Samples der Klangkünstlerin kommt noch eine eigene Ebene hinzu, die die „klassische“ Musik ja nicht „stört“, sondern sich mit ihr verbindet und etwas Neues entstehen lässt.

Wie reagiert das Publikum? Welche Reaktionen überraschen am meisten?
Naja, wir spielen ja auch mit Erwartungshaltungen. Wenn ich ein Konzert besuche, erwarte ich, dass die Künstler*innen auf einer Bühne im Rampenlicht stehen. Hier aber sind die Musiker*innen verborgen, sie werden mir sozusagen erstmal vorenthalten. Ich muss also selbst aktiv werden und eine Grenze – die der Box – überwinden, um das tatsächliche Live-Erlebnis zu haben. Allein da ergeben sich spannende Eigendynamiken zwischen den Besucher*innen, die sich zum Beispiel nur dann trauen, eine der Boxen zu betreten, wenn sie gesehen haben, dass andere das auch tun. Wollten mehrere gleichzeitig in eine Box, müssen sie kooperieren und sich über eine Reihenfolge verständigen, da immer nur eine Person hinein darf. Ich finde, das Ganze ist auch eine Art Publikumsperformance.
Und manchmal wird dabei das Publikum selbst zum Darstellenden, oder?
Ja, es ist schon vorgekommen, dass Besucher*innen die Musiker*innen während des Spielens in ein Gespräch verwickeln, das dank der Mikrofone für alle hörbar ist. Das beeinflusst dann auch den weiteren Verlauf. So etwas ist in einem konventionellen Konzert ja undenkbar.
Wie viel bei FERNSTE GELIEBTE ist Improvisation?
Für die fünf Stunden haben wir nur einen groben Ablaufplan als Grundgerüst entwickelt. In München hatten wir deshalb zwei Aufführungen, die völlig unterschiedlich waren. Das Resultat war abhängig vom Publikum, aber auch von Tagesform sowie körperlicher und emotionaler Verfassung der Performenden.

Für die Künstler*innen muss das extrem anstrengend sein.
Absolut! Fünf Stunden auf höchstem Niveau zu musizieren und dauerhaft präsent zu sein, ist alles andere als Tagesgeschäft. Aber genau diese Grenzerfahrung wollen wir unbedingt. Eine Dauer von einer Stunde wäre zu harmlos. Erst nach drei bis vier Stunden kommen die Performenden an körperliche Grenzen und verspüren wirklich den sehnlichen Wunsch, die anderen wieder sehen zu können und aus der Isolation befreit zu werden. Sie müssen diese unüberwindbare Distanz also nicht schauspielern, sondern sie durchleben sie tatsächlich – und das spürt man bei der Aufführung. Das ist ganz entscheidend!
In welcher Umgebung könnte man die Produktion wiederaufführen?
Grundsätzlich ist das überall denkbar! Zu-mal das Konzept die Freiheit bietet, inhaltlich auf die Umgebung und den räumlichen Kontext einzugehen, ihn auch in der Performance zu thematisieren.
Wäre FERNSTE GELIEBTE auch auf Zoom, Skype oder Teams denkbar?
Natürlich sind diese Videochat-Plattformen das Sinnbild dafür, mit Kommunikationsmitteln räumliche Distanzen zu überwinden und fehlende körperliche Nähe zu kompensieren – mit allen Störfaktoren und Defiziten, die so ein Videochat mit sich bringt. Im Grund haben wir eine analoge Variante davon gemacht.